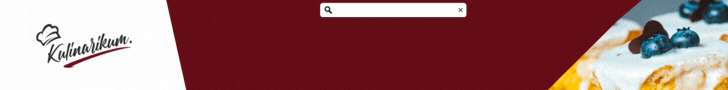Die Entscheidung Frankreichs zum Abzug seiner Truppen aus Mali hat in Deutschland die Debatte über die Zukunft des Bundeswehreinsatzes dort angeheizt. Vertreter der Bundesregierung ließen am Donnerstag zunächst zwar offen, ob die bis Ende Mai befristete Beteiligung der Bundeswehr an zwei Mali-Einsätzen verlängert werden soll. Auswärtiges Amt und Bundesverteidigungsministerium zeigten sich aber sehr besorgt über die schwierigen politischen Begleitumstände des Einsatzes unter der malischen Militärjunta.
Die deutschen Soldaten in dem afrikanischen Krisenland engagieren sich in zwei internationalen Einsätzen: Bei der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali, in der malische Streitkräfte ausgebildet werden, und bei der UN-Stabilisierungsmission Minusma, die zum Schutz der Zivilbevölkerung beitragen soll.
Als politisch schwierig gilt derzeit insbesondere die Mission EUTM Mali: Hier wird die malische Armee ausbildet, deren Vertreter eine demokratisch gewählte Regierung aus dem Amt geputscht hatten. Möglicherweise wird die Bundesregierung unterschiedliche Entscheidungen bei der Verlängerung des EU- und des UN-Einsatzes treffen.
Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte, sie sei „sehr skeptisch“, ob das Bundeswehrmandat für EUTM Mali aufrecht erhalten werden könne. Auch die Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission Minusma stehe in Frage.
Außen-Staatsministerin Katja Keul (Grüne) erklärte: „Wir müssen unterscheiden zwischen der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali und der UN-Stabilisierungsmission Minusma, die bei der Umsetzung des Friedensabkommens unterstützt und zum Schutz der Zivilbevölkerung beiträgt.“
Abgesehen von den politischen Erwägungen steht das Engagement der Bundeswehr auch aus ganz praktischen Erwägungen in Frage: Der Abzug der Franzosen dürfte eine Lücke bei der UN-Mission Minusma reißen, weil die Franzosen dort bisher den Schutz der Soldaten mit Kampfhubschraubern gewährleisten und auch ein Lazarett stellen.
„Für uns stellt sich nun die Frage, wer die Fähigkeiten, unsere Soldaten und Soldatinnen aus der Luft zu schützen, nun kompensiert“, sagte die Vorsitzende des Bundeswehr-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Nachrichtenagentur AFP. Eine Voraussetzung für einen möglichen Verbleib der Bundeswehr sei, „dass unsere Soldaten und Soldatinnen bestens geschützt werden müssen“.
Verteidigungsministerin Lambrecht sagte in Brüssel, wenn der militärische Beitrag der Franzosen nun wegfalle, müsse „dringend eine Lösung“ gesucht werden – etwa durch eine Unterstützung durch Frankreich aus dem benachbarten Niger oder durch andere Partner. Das wäre nach ihren Angaben aber „ein völlig verändertes Mandat“ und müsste mit dem Bundestag neu diskutiert werden.
Frankreich hatte vor allem politische Probleme mit der Militärjunta in Bamako für seine Abzugsentscheidung geltend gemacht: Der Élysée-Palast verwies auf die Verschiebung der Wahlen und „zahlreiche Behinderungen“ durch die malische Militärjunta. Ministerin Lambrecht und Staatsministerin Keul schlossen sich dieser Kritik Frankreichs ausdrücklich an und zeigten Verständnis für die Rückzugsentscheidung.
Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) warnte die Bundesregierung davor, dem Beispiel Frankreichs zu folgen. „Das darf nicht das Ende des kompletten internationalen Engagements sein – gerade auch nicht des deutschen“, erklärte Wadephul. Beide Missionen – Minusma und EUTM Mali – seien wichtig. Ein Abzug würde ein sicherheitspolitisches Vakuum in Mali schaffen, das von Dschihadisten oder von russischen Verbänden gefüllt werden könnte.
Einen Komplettabzug der Bundeswehr forderte hingegen die Linksfraktion. „Der militärische Abzug der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich aus Mali ist richtig und überfällig“, erklärte deren Außenexpertin Sevim Dagdelen. „Berlin muss seinerseits die Reißleine ziehen und die deutschen Soldaten umgehend aus dem westafrikanischen Land zurückholen.“
Der Einsatz der Bundeswehr in Mali hat bisher knapp zwei Milliarden Euro gekostet. Dies berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf das Einsatzführungskommando. Dabei handele es sich um „einsatzbedingte Zusatzausgaben“. Die Kosten des Afghanistan-Einsatzes beliefen sich auf rund zwölf Milliarden Euro.