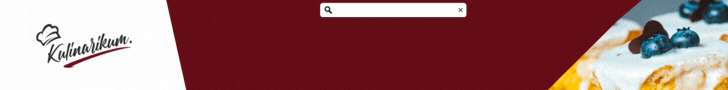Eine Krise kommt selten allein. Und so hängt mit der Klimakrise das massive Artensterben rund um den Globus eng zusammen. Über Maßnahmen gegen den Artenverlust wird ab dem 25. April beim UN-Biodiversitätsgipfel im chinesischen Kunming verhandelt. Bei den Vorverhandlungen in Genf, die am Dienstag zu Ende gehen, hat sich Geld als Knackpunkt erwiesen. Denn um Ökosysteme, Pflanzen und Tiere zu erhalten, müssten die Staaten hohe Summen in die Hand nehmen und Milliardensubventionen für umweltschädliche Wirtschaftszweige einstellen.
Laut einer Studie des Bündnisses Business for Nature fließen jährlich mindestens 1,8 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) an staatlichen Subventionen, also zwei Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes, in Wirtschaftsbereiche, die zur Zerstörung der Natur führen.
Andere Untersuchungen setzen diese Summe nicht ganz so hoch an. Sie stimmen aber darin überein, dass die Welt deutlich mehr Geld in umweltschädliche Aktivitäten steckt, als sie für den Schutz der Erde ausgibt. Entsprechend wurden bislang praktisch alle internationalen Artenschutz-Zielvorgaben verfehlt.
An einem Text zum besseren Schutz der Artenvielfalt arbeiten die 196 Mitgliedstaaten der internationalen Biodiversitätskonvention (CBD) seit zwei Wochen in Genf. Das Weltnaturabkommen mit Zielvorgaben für 2030 soll in einigen Wochen in Kunming beschlossen werden.
Knackpunkt ist wieder einmal das Geld. „Die Mobilisierung der Ressourcen ist ein brenzliges Thema des Treffens geworden“, sagt der ghanaische Artenschutz-Experte Alfred Oteng-Yeboah. „Es ist ein Balanceakt.“
Deutsche Umweltverbände warnten am Freitag auch wegen der Finanzierungsfrage vor einem Scheitern des neuen Weltnaturabkommens. Bei den Gesprächen in Genf fehle es „an Ehrgeiz und politischem Willen“, kritisierten Nabu, BUND, Greenpeace und andere Umweltorganisationen. „Nur wenn insbesondere den Ländern des globalen Südens genug Geld für die Umsetzung zugesagt wird, kann die Verabschiedung noch gelingen.“
Der in Genf diskutierte Entwurf sieht vor, die Finanzmittel für den Artenschutz auf 200 Milliarden Dollar pro Jahr aufzustocken und die umweltschädlichen Subventionen jährlich um mindestens 500 Milliarden Dollar zu kürzen. Jährlich mindestens zehn Milliarden Dollar für den Artenschutz sollen an ärmere Länder gehen.
Den Entwicklungs- und Schwellenländern ist das aber zu wenig. Guatemala etwa fordert 60 Milliarden Dollar jährlich für ärmere Länder. Der Vorsitzende von Indiens Nationaler Behörde für Biodiversität, Vinod Mathur, spricht von 100 Milliarden Dollar an „neuen, zusätzlichen, schnellen Geldern“. Ohne eine solche Finanzierung seien ehrgeizige Artenschutzziele unrealistisch, argumentiert er.
Zur Zeit finanziert die Globale Umweltfazilität (GEF) Artenschutzprojekte. Die Entwicklungsländer klagen aber, der Fonds arbeite zu langsam und gewähre zu geringe Summen. Einige Staaten fordern daher die Einrichtung eines neuen Fonds. Dies würde aber Jahre dauern, halten andere Länder dem entgegen.
Die reichen Länder „erkennen an, dass zusätzliche Anstrengungen notwendig sind“, sagt einer ihrer Vertreter in Genf. Die geforderten Summen weisen sie aber zurück. Vielmehr sollten mehr Gelder aus der Privatwirtschaft mobilisiert und vorhandene Mittel besser genutzt werden, heißt es.
Die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen in Landwirtschaft, Fischerei und im Energiesektor ist allerdings ein heißes Eisen. Viele Regierungen verteidigen die Subventionen als Unterstützung für arme Menschen, aber „die Hauptnutznießer sind oft die reichsten“, sagt Ronald Steenblick, der an der Studie von Business for Nature mitgearbeitet hat. So flössen 80 Prozent der Fischereisubventionen an den industriellen Fischfang, nicht an kleine Fischer.
Die mehr als tausend Unternehmen, die Business for Nature angehören, fordern ein Artenschutzabkommen mit klarer Kante – und das auch aus wirtschaftlichen Interessen, wie die Chefin des Zusammenschlusses, Eva Zabey, sagt. Die Unternehmen bräuchten „politische Sicherheit für Investitionen, Innovationen, Veränderungen ihrer Aktivitäten – und das schnell“.